Das Öffentlichkeitsprinzip im Kanton Uri stärken
- Advocacy
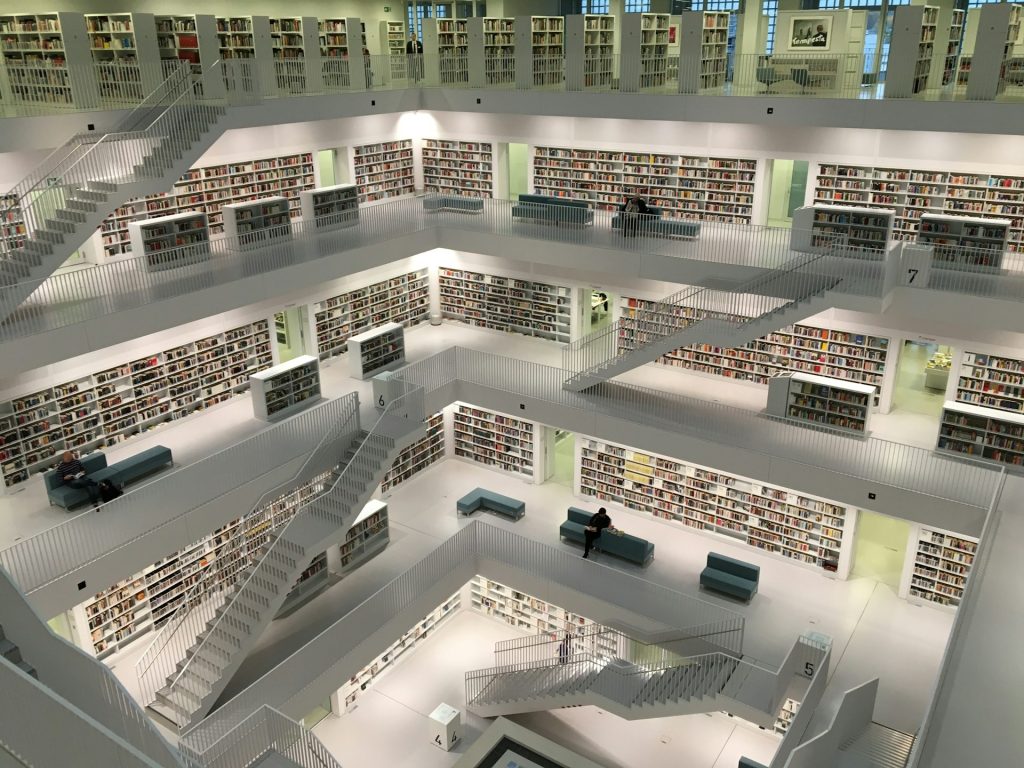
Basel, 23.01.2025
Vernehmlassungsantwort zur Teilrevision des Gesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der kantonalen Verwaltung im Kanton Uri
Opendata.ch hat die ihr gebotene Gelegenheit wahrgenommen, an der “Vernehmlassung betreffend Änderung des Gesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der kantonalen Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz; OeG)” des Kantons Uri teilzunehmen. Die Vorlage birgt noch Einiges an Verbesserungspotential.
Fragen des Kantons zur Vernehmlassungsvorlage und unsere Antworten dazu
I. Geltungsbereich
Frage 1
Die Vorlage sieht in Artikel 2 Absatz 1 OeG vor, dass das Öffentlichkeitsgesetz künftig auch für die Einwohnergemeinden gilt.
Damit wird einem Anliegen der erheblich erklärten Motion Ludwig Loretz, Andermatt, zu «Offenheit und Transparenz in Uri» nachgelebt.
Was ist Ihre Haltung zur Ausweitung des Öffentlichkeitsprinzips auf die Einwohnergemeinden?
Antwort Opendata.ch: Einverstanden
Bemerkungen: keine
Frage 2
Die Vorlage sieht in Artikel 2 Absatz 3 OeG vor, dass das Gesetz wie bisher nicht für die Urner Kantonalbank und neu generell auch nicht für die Bereiche gilt, in denen die Gemeinwesen am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen und privatrechtlich und nicht in Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe handeln.
Auch dieser Punkt ist ein Anliegen der erheblich erklärten Motion Ludwig Loretz, Andermatt, zu «Offenheit und Transparenz in Uri».
Was ist Ihre Haltung dazu?
Antwort Opendata.ch: Bedingt einverstanden
Bemerkungen: Mit Blick auf die offenen Behördendaten möchten wir anmerken, dass gerade eine Kantonalbank beispielsweise über wertvolle Daten zur wirtschaftlichen Situation und Entwicklung eines Kantons verfügt, welche von öffentlichem Interesse sind und deshalb auch frei genutzt werden können sollten. Das dürfte auch für andere, wirtschaftlich orientierte Unternehmungen, die dem Kanton oder den Gemeinden gehören, gelten. Ein absoluter Ausschluss scheint uns deshalb falsch; der Ausschluss sollte wie bei anderen Daten auf den Schutz überwiegender privater und öffentlicher Interessen – Daten- und Informationsschutz – beschränkt bleiben. Die öffentlichen Unternehmungen wie die SBB sind ja auf Bundesebene wichtiger Teil der Infrastruktur der offenen Behördendaten. Zudem sollte das Gesetz auch weiterhin auf öffentliche und private Gesundheitseinrichtungen anwendbar bleiben, wenn diese einen staatlichen Leistungsauftrag erhalten.
II. Vorbehaltene Regelungen
Frage 3
Mit Artikel 2a OeG wird zur Klärung und Verdeutlichung neu eine Vorbehaltsnorm eingefügt, wonach
- der Zugang zu amtlichen Dokumenten, die Personendaten der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers enthalten, sich nach dem kantonalen Datenschutzgesetz richtet (Abs. 1) und
- gesetzliche Regelungen, die bestimmte Informationen als geheim bezeichnen oder von diesem Gesetz abweichende Voraussetzungen für den Zugang zu bestimmten Informationen vorsehen, vorbehalten bleiben (Abs. 2).
Sind Sie damit einverstanden, dass diese speziellen Regelungen dem Öffentlichkeitsgesetz generell vorgehen?
Antwort Opendata.ch: Bedingt einverstanden
Bemerkungen: Wir sind mit dieser Regelung grundsätzlich einverstanden, müssen aber darauf hinweisen, dass Zugangs- und Nutzungsverweigerungen von (offenen Behörden-) Daten sich oft auch in ungerechtfertigter Weise auf daten- oder informationsschutzrechtliche Begründungen stützen. Wir finden es deshalb angebracht, einen Zusatz einzufügen im Sinne von: Vorbehalten bleibt der Schutz legitimer und überwiegender Datenschutz- oder Geheimhaltungsinteressen (Informationsschutz).
Artikel 6 Abs. 1 dieses Gesetzes ist diesbezüglich aus unserer Sicht besser formuliert. Vielleicht genügt auch eine einzige Bestimmung im ganzen Gesetz.
III. Offene Verwaltungsdaten
Frage 4
Artikel 4 OeG definiert neu die Begriffe «offene Verwaltungsdaten» und «Datensatz». Offene Verwaltungsdaten sind amtliche Dokumente in Form von Datensätzen, die frei zugänglich gemacht und ohne Nutzungseinschränkung bereitgestellt werden und bei denen für Zugang und Nutzung keine Gebühren erhoben werden (Abs. 1). Ein Datensatz ist eine thematisch abgrenzbare Sammlung von inhaltlich zusammenhängenden und strukturierten digitalen Daten (Abs. 2).
Die Begriffsdefinition der offenen Verwaltungsdaten steht im Zusammenhang mit der Umsetzung des überwiesenen Postulats Kurt Gisler, Altdorf, zu «Uri publiziert und nutzt Open Government Data».
Sind Sie mit diesen Definitionen einverstanden?
Antwort Opendata.ch: Bedingt einverstanden
Bemerkungen: Wir haben den Eindruck, dass die Begriffsdefinitionen noch zu eng an der Papierwelt bzw. an der traditionellen Datenverarbeitung orientiert sind und schlagen ein weiteres Datenverständnis vor:
Bei Daten handelt es „sich um alle isolierten oder isolierbaren Einheiten, die maschinell bearbeitet und analysiert werden können. Dabei handelt es sich beispielsweise um intentional hergestellte Daten (z. B. Statistiken, Finanzdaten, Registerdaten), um Messdaten (z. B. Wetterdaten, gewisse Geodaten, Verkehrsmessungen), aber auch um andere Informationen, die als Daten behandelt werden können, wie Listen (z. B. Krankenkassenprämien, verbotene Substanzen, Güter, die nicht ausgeführt werden dürfen), strukturierte oder unstrukturierte Texte (z. B. Archiv- oder Bibliothekskataloge, Rechtstexte) oder auch Multimediaproduktionen (digitale Bild-, Ton- oder Videodokumente mitsamt ihren Metadaten). Aufgrund der Schwierigkeit, die betroffenen Daten für alle Verwaltungseinheiten passend in einer Querschnittsbestimmung positiv zu definieren, wird der Ansatz verfolgt, dass grundsätzlich alle Daten nach den Grundsätzen von OGD zu publizieren sind, ausser sie fallen in eine der klar definierten Ausschlusskategorien.“ (aus der Botschaft zum Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (S. 42) [https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/70496.pdf])
Frage 5
Artikel 5a OeG regelt neu die «zur Verfügungstellung von offenen Verwaltungsdaten». Vorgesehen ist, dass der Regierungsrat und der Gemeinderat für ihr Gemeinwesen die Voraussetzungen festlegen, unter denen offene Verwaltungsdaten frei zur Verfügung gestellt werden. Sie beide sollen in für ihre Bereiche Verfahren, Ansprüche, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Umgang mit offenen Verwaltungsdaten regeln.
Dass offene Verwaltungsdaten vermehrt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, ist ein Anliegen des Postulats Kurt Gisler, Altdorf, zu «Uri publiziert und nutzt Open Government Data».
Der Vorschlag, die Regelungskompetenz an die Exekutivbehörden (Regierung und Gemeinderat) zu delegieren, beruht auf der Überlegung, dass damit bedarfsgerechte und massgeschneiderte Lösungen erreicht werden können, so dass die Gemeinwesen personell, finanziell und administrativ nicht überfordert werden.
Was ist Ihre Haltung zu dieser Lösung?
Antwort Opendata.ch: Bedingt einverstanden
Bemerkungen: Wir plädieren für den Grundsatz open by default: Behördendaten sollen standardmässig als offene Daten zur Verfügung gestellt werden. Es sind also die Ausnahmen von der Publikationspflicht stichhaltig zu begründen, gestützt auf legitime und überwiegende Daten- und Informationsschutzrechte. Die Publikation hat dann zentral zu erfolgen, so dass der Aufwand für die Suche nach Daten minimiert wird (Portallösung wie beim Bund resp. vielen Kantonen). Dass die Exekutivbehörden die Umsetzung des Grundsatzes open by default konkretisieren, ist u. E. richtig, allerdings scheint uns eine kantonsweit einheitliche Lösung angezeigt, um einer schwer überschaubaren Vielfalt unterschiedlicher Gemeindelösungen zuvorzukommen.
IV. Weitere Revisionspunkte
Frage 6
In Artikel 5 Absatz 2 OeG wird aufgrund des geänderten Geltungsbereichs neben dem Regierungsrat neu auch der Gemeinderat genannt, der über die Arbeit der Verwaltung informiert. Wie bisher kann diese Aufgabe den Direktionen oder Verwaltungsstellen übertragen werden, soweit deren Tätigkeitsbereich betroffen ist.
Was ist Ihre Haltung dazu?
Antwort Opendata.ch: Einverstanden
Bemerkungen: keine
Frage 7
Nach Artikel 6 Absatz 1 OeG hat künftig «jede Person» das Recht, amtliche Dokumente einzusehen und von den Behörden Auskünfte über den Inhalt amtlicher Dokumente zu erhalten, soweit nicht überwiegende öffentliche oder schützenswerte private Interessen entgegenstehen. Bislang war das Einsichtsrecht in Uri nur «volljährigen Person», also Personen über 18 Jahren vorbehalten. Was Sinn und Zweck sowie Motiv für diese Einschränkung war, geht aus den Materialien nicht hervor. Jedenfalls steht Uri mit dieser Einschränkung bis heute schweizweit allein dar. Die Einschränkung soll daher fallen gelassen werden.
Was ist Ihre Haltung dazu?
Antwort Opendata.ch: Einverstanden
Bemerkungen: Zu Artikel 6 Abs. 2 und 3: Auf den Konjunktiv (“könnte”, “würde”) ist zu verzichten, weil dies der Rechtspraxis des Bundes sowie der meisten Kantone widerspricht. Eine konkretisierte Formulierung trägt dazu bei, unnötige Rechtsverfahren über theoretische Möglichkeiten einer allfälligen Einschränkung der geschützten öffentlichen Interessen zu vermeiden und sorgt für mehr Rechtssicherheit.
Frage 8
Artikel 6a OeG regelt die Einschränkung und Verweigerung des Zugangs zu amtlichen Dokumenten. Dies in Anlehnung an die heutige Regelung und die Rechtsprechung dazu. Neu ist in Absatz 5 ausdrücklich vorgesehen, dass Gesuche zum Zwecke der Ausforschung, mit denen ohne thematische Abgrenzung in nicht näher bestimmten Dokumenten nach etwas gesucht wird, das allenfalls ein vertieftes Wissen lohnen könnte, nicht unter den Schutz des Öffentlichkeitsgesetzes fallen. Diese Regelung will sog. «fishing expedition» verhindern. Offenbar sind in anderen Kantonen solche (verpönten) Anfragen auf gut Glück zu Ausforschungszwecken zunehmend, was hohen Verwaltungsaufwand verursacht.
Was ist Ihre Haltung zu dieser Regelung, die «fishing expedition» verhindern will?
Antwort Opendata.ch: Nicht einverstanden
Bemerkungen: Wir verstehen die Absicht, aber die Gefahr ist, dass hier sozusagen das Kind mit dem Bad ausgeschüttet wird. Wir sind der Meinung, dass heute dieses Risiko eingegangen werden muss. Bei einem generellen Ausschluss von breiten Gesuchen besteht das Risiko, dass legitime Informationsanliegen von vornherein abgeblockt werden. Stattdessen sollte die Verhältnismässigkeit geprüft werden. Die Behörde kann im Dialog mit den Antragstellenden die Anfrage konkretisieren lassen. Für besonders aufwändige Gesuche könnten Gebühren erhoben werden, um unverhältnismässige Belastungen der Verwaltung zu verhindern. Bei Daten, die publiziert sind, entfällt der Aufwand für die Datenbereitstellung im Einzelfall ohnehin.
Frage 9
Nach geltendem Recht müssen Gesuche um Einsicht in amtliche Dokumente schriftlich und unterschrieben eingereicht werden (Art. 8 OeG). In der heutigen Praxis werden auch Mailanfragen entgegengenommen und beantwortet. Künftig braucht es explizit keine Unterschrift mehr und das Gesuch kann elektronisch eingereicht werden. Diese Vereinfachung ist auch ein Anliegen der erheblich erklärten Motion Ludwig Loretz, Andermatt, zu «Offenheit und Transparenz in Uri».
Was ist Ihre Haltung dazu?
Antwort Opendata.ch: Bedingt einverstanden
Bemerkungen: Für den Zugang zu amtlichen Dokumenten ist das grundsätzlich ok; der Zugang zu Behördendaten i.w.S. dagegen sollte ohne Gesuch möglich sein, wenn der Grundsatz open by default angewandt wird.
Nicht nur Gesuchstellende, sondern auch die Verwaltung sollte verpflichtet werden, Medienschaffende und andere Gesuchstellende möglichst rasch über die vorhandenen Dokumente zu einem Thema zu informieren. Auf diese Weise können Zugangsgesuche gezielt und präzise gestellt werden, was den Verwaltungsaufwand zusätzlich minimiert und die Transparenz fördert.
Frage 10
In Analogie zur Übergangsbestimmung vor gut 20 Jahren, als das Öffentlichkeitsprinzip für den Kanton eingeführt wurde, sieht die Gesetzesvorlage in Artikel 11a OeG vor, dass es nur auf diejenigen amtlichen Dokumente der Gemeinden anwendbar ist, die von den Gemeindebehörden nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Gesetzesrevision erstellt oder empfangen wurden.
Was ist Ihre Haltung zu dieser Übergangsbestimmung?
Antwort Opendata.ch: Bedingt einverstanden
Bemerkungen: Insofern die Publikation von Behördendaten durchaus mit Aufwand verbunden ist, haben wir Verständnis dafür. Eine rückwirkende Publikation digital vorliegender Daten ist aber ins Auge zu fassen, da in vielen Fällen der Wert von Daten gerade in langen Zeitreihen besteht. Für Daten, die zuerst digitalisiert werden müssten, ist das weitere Vorgehen bei diesem Vorbehalt sorgfältig zu prüfen; es kann auch im Interesse der Behörden liegen, solche Datenreihen zu digitalisieren.
Weitere Anmerkungen
Art. 9 Kosten für den Zugang zu amtlichen Dokumenten
Bedauerlich ist, dass im Kanton Uri lediglich mündlich erteilte Auskünfte und die Einsichtnahme vor Ort “in der Regel” kostenlos sind. Zeitgemäss müsste dies auch für die Zustellung elektronischer Dokumente gelten. Darüber hinaus sieht das Gesetz vor, dass Gebühren bei “nicht unerheblichem” Aufwand erhoben werden können. Es ist legitim, dass sich die Verwaltung gegen ausufernde Zugangsgesuche wehrt, die in keinem Verhältnis zum öffentlichen Interesse stehen. Dies sollte im Gesetz klar formuliert werden, beispielsweise so: “Gebühren können erhoben werden, wenn der Aufwand für die Bearbeitung eines Zugangsgesuchs besonders hoch ist und das öffentliche Interesse am Zugang die entstehenden Kosten nicht rechtfertigt.”
Die Regelung zur Erhebung von Gebühren bei “regelmässig wiederholten Gesuchen” hingegen dient dem Öffentlichkeitsprinzip nicht. Es kann durchaus im öffentlichen Interesse liegen, dass Medienschaffende und weitere interessierte Akteure regelmässig ein internes Jahresreporting abrufen, um die im Gesetz vorgesehene öffentliche Kontrolle der Verwaltung zu gewährleisten. Diese Regelungen muss gestrichen werden, um die vom Gesetzgeber grundsätzlich eingeforderte Transparenz zu gewährleisten.
Fehlende Bearbeitungsfristen
Die Nennung klarer Fristen im Gesetz stärkt das Vertrauen in die Verwaltung und erhöht die Effizienz der Bearbeitung. Fristenregelungen sind auch beim Bund und in fast allen Kantonen üblich.
Einsichtnahme
Dokumente sollten standardmässig per E-Mail versandt werden. Elektronische Akten können effizient bearbeitet werden, etwa bei notwendigen Schwärzungen, und die Weiterleitung per E-Mail ist ein logischer, effizienter Abschluss. Das Gesetz sollte zukunftsorientiert gestaltet werden.
